Kunst & Computerspiel – Ästhetik, Narrativität und Ludiziät - Referat 11
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen. - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von Ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
Es folgen meine Aufzeichnungen zum Kunst-Medien-Praxis Seminar "Hybrid Moments & Uncanny Spaces".
An meinen Dozenten: Bitte ignorieren Sie es, wenn manche Seiten dieser Website noch nicht sinnvoll gefüllt sind - dieses Projekt hab ich erst kurz vor dem Semesterstart angefangen und hab dementsprechend nur begrenzt viel machen können. Diese Website dient derzeit mehr als Plattform für das Werkstattbuch.
Thematische Einführung zur (Post-)Digitalität und Digitalisierung
Außerdem:
Technoscience, Akteur-Netzwerk-Theorie und Cyborg-Feminismus
Technoscience: Verflechtung von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft – nicht neutral, sondern geprägt von Macht, Normen und Interessen.
Cyborg-Manifest: Donna Haraways feministisches Plädoyer für hybride Identitäten jenseits von Natur/Kultur- und Mann/Frau-Dichotomien.
Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT): Ansatz, der Menschen und Dinge (Akteure) als gleichwertige Teile von Netzwerken begreift, die gemeinsam Realität herstellen.
Reflexion der digitalen Exploration (SculptGL).
Zu Beginn wurde kurz die Organisation der bevorstehenden Exkursion besprochen. Anschließend folgte das erste Referat:
1. Referat: Frühe interaktive Medienkunst, Computerkunst, und Browser Art
Frühe Medienkunst nutzte neue Technologien wie Computer, Video und Oszilloskope als künstlerisches Ausdrucksmittel – Technik wurde zum kreativen Werkzeug.
Interaktivität war zentral: Rezipient:innen wurden aktiv in das Kunstwerk einbezogen, z.B. bei “Tapp und Tastkino” oder “Hole in Space”.
Mensch-Maschine-Verhältnisse wurden hinterfragt – etwa durch Werke von Nam June Paik oder Valie Export, die Körper, Code und Wahrnehmung thematisierten.
Netzkunst ab den 1990ern verschob den Kunstraum ins Internet: Künstler:innen wie JODI oder Mark Napier dekonstruierten digitale Oberflächen und Strukturen.
Kunst als kritisches Medium zeigte früh, dass Technologie nicht neutral ist – sie stellt Fragen nach Macht, Zugang und Teilhabe in einer digitalen Gesellschaft.
2. Referat: Cyber- und Netzfeminismus
Cyberfeminismus nutzt Technologie als Mittel feministischer Kritik und Selbstermächtigung, oft mit subversivem, ironischem Ton.
Netzfeminismus entsteht in sozialen Medien und kämpft für Sichtbarkeit, Repräsentation und gegen patriarchale Machtverhältnisse.
Zentrale Themen sind die Dekonstruktion von Geschlechterrollen, der „female gaze“ und die Aneignung digitaler Räume.
Künstlerische Kollektive wie VNS Matrix, das Old Boys Network oder The Nap Ministry prägen die Bewegung mit provokanten Aktionen.
Kritik richtet sich an die Nähe zu neoliberalen Idealen (Selbstoptimierung, Konsumismus) und die oft privilegierte Perspektive der Akteur:innen.
3. Referat: Memes: Ästhetische und kritische Dimension von Bild/Text Formaten in Kunst und Netz
In Anknüpfung an Avantgarde und Pop-Art erscheinen Memes als subversive, postdigitale Ausdrucksformen, die Fragen nach Autorschaft, Reproduzierbarkeit und Machtstrukturen sichtbar machen.
4. Referat: Ästhetiken digitaler Teilhabe: Partizipation, Performance, #Post Partizipation?
Likes, Klicks und Shares erzeugen nur den Anschein von Mitbestimmung; post-partizipative Kunst dekonstruiert diese Scheinbeteiligung und hinterfragt ihre Einbindung in kommerzielle Plattformlogiken.
Akteur-Netzwerk-Theorie: Digitale Teilhabe wird als Zusammenspiel menschlicher und nicht-menschlicher Akteure sichtbar, wodurch Macht- und Kontrollstrukturen in Medienkunst offengelegt werden.
Hier geht es zum ausführlichen Beitrag darüber.
5. Referat: Erweiterte Realitäten und Phygitale Überlagerungen: AR, VR und XR in künstlerischer Praxis und Kunstrezeption
6. Referat: Vom Internet der Dinge zur New Aesthetic – postdigitale Impulse in Malerei, Plastik und Installation
Frühe Internetkultur gestalten digitale Normen und Werte, Mitgestaltung im Alltag
7. Referat: Körper 2.0: Avatare, Cyborgs und digitale Körperpolitiken
Digitale Repräsentationen beeinflussen Selbstwahrnehmung und Handlungen (z. B. Proteus-Effekt) und zeigen, wie eng virtuelle Körperbilder mit realem Verhalten und sozialer Identität verknüpft sind.
Zwischen transhumanistischer Euphorie und posthumanistischer Kritik wird deutlich: kritische Medienkompetenz ist notwendig, um digitale Körperpolitiken reflektieren zu können.
8. Referat: Generative Ästhetiken: Kritische Perspektiven auf KI-Ästhetik, Repräsentation und Robotik
Dies Academicus.
Ausflug in die Ausstellung.
9. Referat: Surveillance/Sousveillance Art – künstlerische Transformationen und Interventionen
10. Referat: Glitch als Lösung? – Fehler und Ambiguität als queer-feministische Strategie
Störung wird auf Körper und Identitäten übertragen – Abweichung gilt nicht als Defizit, sondern als Widerstand gegen normative Ordnungen.
Glitches entziehen sich Perfektion und Verwertbarkeit, machen Macht- und Kapitalstrukturen erkennbar und eröffnen alternative postdigitale Perspektiven.
9. Referat: Kunst & Computerspiel – Ästhetik, Narrativität und Ludiziät
Künstlerische Aneignungen über Modding, Machinima, Glitching oder Art Games machen Macht, Kontrolle, Identität und Ideologie erfahrbar.
Game Art eröffnet neue Formen der Medienkritik und kann im Unterricht handlungsorientiert genutzt werden, um Macht- und Repräsentationsfragen spielerisch zu reflektieren.
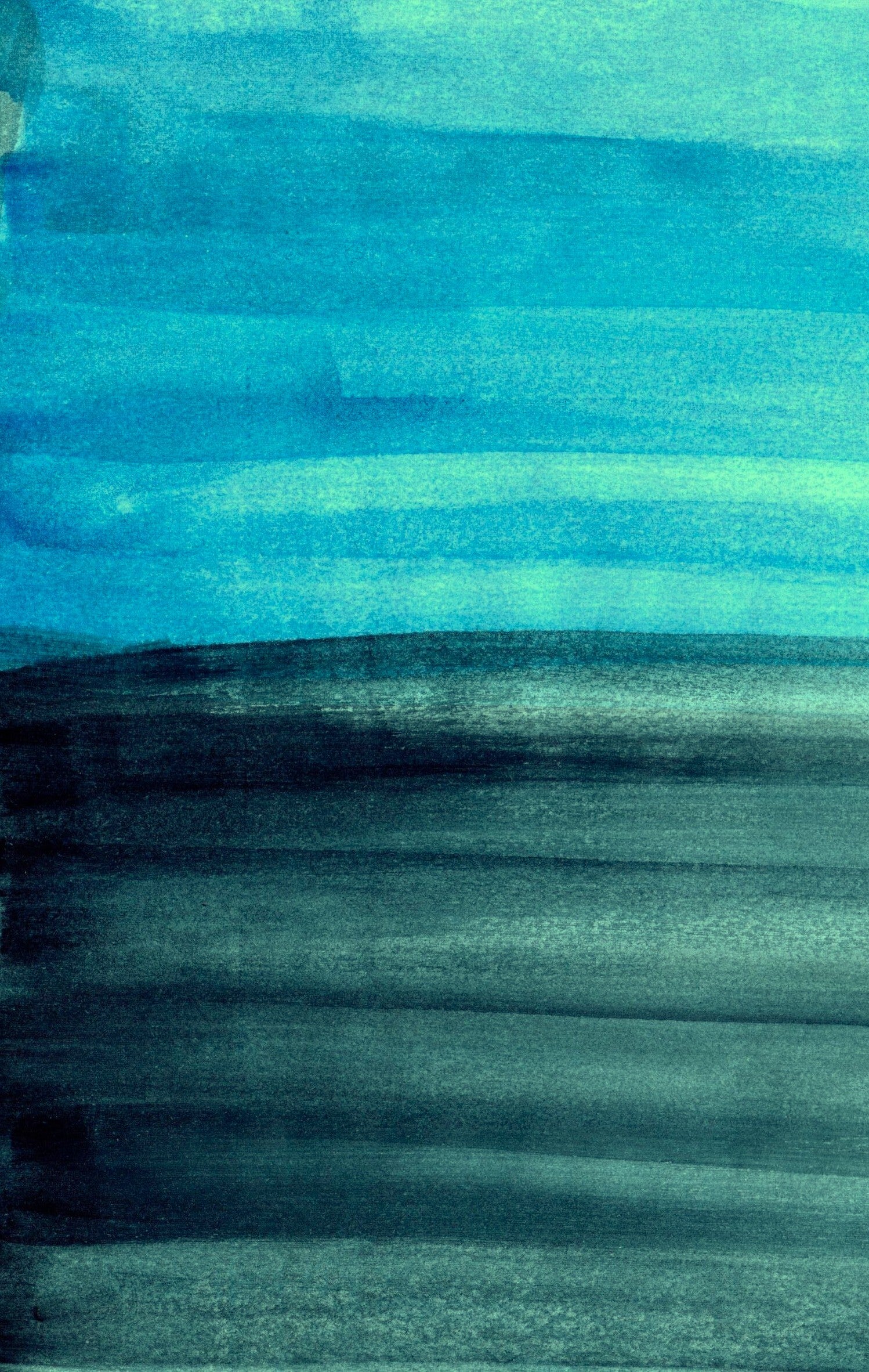
Der Begriff Post-Digitalität beschreibt eine Phase, in der digitale Technologien so tief in unseren Alltag integriert sind, dass sie nicht mehr als außergewöhnlich oder neu wahrgenommen werden. Wir leben in einer Zeit, in der digitale Tools, Plattformen und Prozesse allgegenwärtig und selbstverständlich geworden sind. Dies bedeutet, dass die Grenzen zwischen digitaler und physischer Welt zunehmend verschwimmen.

Anstatt digitale Technologien als separate Kategorie zu betrachten, sind sie heute ein integraler Bestandteil unseres Lebens, sei es in der Kommunikation, Arbeit, Bildung oder Kultur. Post-Digitalität ruft dazu auf, nicht mehr nur auf technologische Innovationen zu reagieren, sondern kritisch zu überlegen, wie diese unsere Gesellschaft, Werte und Beziehungen prägen. Es geht also weniger um die Technik selbst, sondern mehr um ihren Einfluss und die Art und Weise, wie wir sie sinnvoll einsetzen.
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen. - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von Ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen. - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von Ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen. - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von Ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen. - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von Ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen. - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von Ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen. - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von Ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
Dies ist eine Übersicht über den Vortrag meiner Kommilitonen - Das nachfolgende Handout ist ebenfalls von ihnen erstellt.Die Impulse sind von unserem Dozenten.
18.07.2025 18:25
Finden Sie eine Möglichkeit, dies zu dokumentieren und im kleinen Rahmen widerspenstig/subversiv/experimentell zu (re-)agieren.
16.05.2025 14:40
Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet Technologien, die dazu entwickelt wurden, Aufgaben zu übernehmen, für die normalerweise menschliche Intelligenz erforderlich ist. Dazu zählen das Verstehen und Verarbeiten von Sprache, das Erkennen von Mustern, das Treffen von Entscheidungen, das Lernen aus Daten sowie die Interaktion mit Menschen in scheinbar natürlicher Weise. Dabei handelt es sich jedoch nicht um „echte“ Intelligenz im menschlichen Sinne, sondern um die Nachbildung bestimmter kognitiver Leistungen durch Algorithmen und Rechenprozesse.
25.04.2025 16:10
In dieser Übung haben wir ein Stück Ton bekommen aus dem wir etwas formen sollten. Außerdem, wurde uns das Tool SculptGL gezeigt, dass als eine Art virtueller Ton dient. Ich kannte dieses Tool tatsächlich vorher schon - fand es aber immer zu Einsteiger-unfreundlich im Layout, da es so viele unübersichtliche Einstellungsmöglichkeiten gibt.
Der Dies Academicus führte uns auf eine Exkursion im kleinen Kreise zur Galerie für zeitgenössischen Kunst in Leipzig.
22.05.2025 20:44
Paule Hammer (geb. 1975 in Leipzig) ist ein Künstler, der in Leipzig lebt und arbeitet. Er studierte Malerei von 1997 bis 2004 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, wo er seinen Meisterschülerabschluss bei Sighard Gille machte.
22.05.2025 20:44
Rodrigo Alcocer de Garay (geb. 1980) ist ein mexikanischer Künstler, der in seiner künstlerischen Praxis die Übergänge zwischen analogen und digitalen Bildkulturen erforscht. Nach einem Architekturstudium an der Universidad Nacional Autónoma de México studierte er Fotografie an der Academia de Artes Visuales in Mexiko-Stadt und an der Neuen Schule für Fotografie in Berlin. 2024 schloss er sein Meisterschülerstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Törsten Hattenkerl ab. Mit selbst entwickelten Techniken untersucht er das Medium Fotografie in seiner materiellen wie gesellschaftlichen Dimension. Seine Arbeiten wurden bereits in Mexiko, Deutschland, den USA, Spanien und Japan gezeigt.
22.05.2025 20:44
Lauren Lee McCarthy ist eine international anerkannte Künstlerin, die soziale Beziehungen im Kontext von Automatisierung, Überwachung und algorithmischem Leben untersucht. Sie ist Just Tech Fellow (2024–26) und war 2022–23 Artist in Residence am Stanford Human Centered AI Institute.
22.05.2025 20:43
Das Seminar Hybrid Moments and Uncanny Spaces hat gezeigt, wie eng Fragen von Kunst, Gesellschaft und Digitalität heute miteinander verflochten sind. Aufbauend auf Nicholas Negroponte’s These, dass das Digitale vor allem durch seine Abwesenheit erfahrbar wird, haben wir untersucht, wie KünstlerInnen im postdigitalen Zeitalter neue Formen von Wahrnehmung, Körperlichkeit und Kritik entwickeln.
Die Auseinandersetzung mit Glitching, Datamoshing, Avataren, Computerspielen oder Memes verdeutlichte, dass digitale Kunst nicht einfach neue Technologien abbildet, sondern deren Strukturen selbst zum Material macht. Fehler, Verzerrungen und hybride Körper eröffnen ästhetische Erfahrungsräume, die Transparenz und Opazität von Software sichtbar machen und damit eine kritische Haltung gegenüber der vermeintlich „selbstverständlichen“ Digitalisierung fördern.
Zentrale Themen wie Ökologie, Postkolonialität, Ökofeminismus oder Afrofuturismus rückten ins Zentrum: Von Fragen nach den Rohstoffen und Arbeitsbedingungen unserer Geräte bis hin zu imaginativen Zukunftskörpern wurde deutlich, dass Postdigitalität nicht nur eine technologische, sondern vor allem eine gesellschaftlich-kulturelle Kategorie ist. Verschiedene künstlerische Positionen zeigen, wie Kunst ökologische und machtpolitische Spannungen reflektieren und alternative Erzählungen sichtbar machen kann.
Besonders für die schulische Praxis liegt der Wert des Seminars in der Verknüpfung von technischen, ästhetischen und kritischen Kompetenzen. SchülerInnen brauchen nicht nur Medienanwendung, sondern auch Medienkritik: Wer baut unsere digitalen Infrastrukturen? Welche Werte schreiben Algorithmen, Avatare oder Spiele in unser Denken ein? Die Reflexion über digitale Alltagsästhetiken – Memes, Games, Avatare – eröffnet niedrigschwellige Zugänge und macht zugleich Machtstrukturen, Diskriminierungen und ökologische Kosten sichtbar.
Es wurde klar: Postdigitalität ist kein fernes Zukunftsszenario, sondern prägt längst unser Handeln und unsere Wahrnehmung. Kunst dient hier als Labor, um alternative Sichtweisen, Widerständigkeit und imaginative Räume zu erproben. Für die Bildungspraxis bedeutet das, auch im Unterricht Räume zu schaffen, in denen technische Fertigkeiten mit kritischer Reflexion verbunden werden können – damit SchülerInnen nicht nur NutzerInnen, sondern auch bewusste GestalterInnen der digitalen Kultur werden.
Erstelle deine eigene Website mit Webador